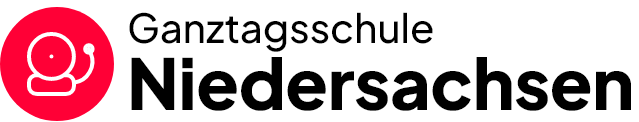Problemorientiertes Lernen in der Schule
In Lerntheorie und Didaktik hat es immer wieder Verschiebungen hinsichtlich der vorherrschenden Strömungen gegeben – und damit auch immer wieder starke Auswirkungen auf die Gestaltung des Schulunterrichts. Die behavioristische Lerntheorie brachte eine Didaktik mit sich, die auf die Konditionierung der Lernenden zielte, die nur passiv reagieren sollten; der Kognitivismus produzierte eine Didaktik, die das Nachvollziehen und Verarbeiten von Informationen in den Vordergrund stellte. Die konstruktivistische Lerntheorie wiederum erkennt die Lernenden als Personen an, die ihre Welt und ihr Wissen aktiv selbst gestalten. Methodisch umgesetzt wird das etwa im Rahmen des sog. Problemorientierten Lernens.
Konstruktivistische Lerntheorie
Während Behaviorismus und Kognitivismus von einem den Lernenden äußerlichen Wissen ausgehen, das diese aufnehmen und (im Falle des Kognitivismus) verstehen sollen, lenkt die konstruktivistische Lerntheorie den Fokus darauf, dass Wahrnehmung, Interpretation und Vorwissen sich von Mensch zu Mensch deutlich unterscheiden. Die jeweiligen Wirklichkeiten der Lernenden werden von diesen selbst gestaltet und differieren so stark, dass es nicht sinnvoll erscheint, sie mit einem vorgegebenen Input zu konfrontieren und einen einer Norm entsprechenden Output zu erwarten. Wissen wird also nicht mehr als korrekte Wiedergabe von äußerlichen Gegebenheiten verstanden, sondern als etwas zutiefst Subjektives, das nur aus dem Eingebundensein in die jeweilige subjektiv-individuelle Wirklichkeit heraus verstehbar ist.
Das hat zur Folge, dass das Ziel des Unterrichts grundsätzlich überdacht werden muss. Die Vermittlung vorgegebenen Wissens kann nicht mehr im Vordergrund stehen, wenn Wissen als subjektiv verstanden wird. Auch die Anpassung an eine vorgegebene Außenwelt erscheint nicht sinnvoll, wenn eine Pluralität nicht vereinbarer je individueller Wirklichkeiten angenommen wird. In der Konsequenz muss der Unterricht offener gestaltet werden, auf die Lernenden als Individuen eingehen und diesen Raum bieten, eigenständig tätig zu werden. Ziel des Unterrichts ist daher nicht mehr das Reproduzieren oder Finden vorgegebener Lösungen, sondern das eigenständige Umgehen mit Problemen und komplexen Situationen.
Das Problemorientierte Lernen
Das Problemorientierte Lernen baut auf dieser Lerntheorie auf und versucht, ausgehend von den Überlegungen des Konstruktivismus, einen Leitfaden für den Unterricht zu entwerfen. Erstmals aufgekommen ist das Konzept indes im Kontext des Medizinstudiums. Dort ist es auch heute noch am weitesten verbreitet, wenngleich es sich prinzipiell in jedem Lernkontext – und damit auch im Schulunterricht – anwenden lässt.
Kern des Problemorientierten Lernens ist der spezifische Aufbau der Unterrichtssituation. Die Lernenden werden mit einem Problem konfrontiert, das sie weitgehend selbstständig bearbeiten sollen. Häufig ist hierbei nicht einmal eine spezifische Fragestellung vorgegeben. Es geht also nicht darum, eine Lösung zu finden, sondern vielmehr darum, das Problem selbst zu analysieren, einen Zugang zu ihm zu finden und darauf aufbauend Vorschläge für die Bearbeitung zu entwickeln.
Hierbei knüpfen die Lernenden an ihr Vorwissen und ihre bisherigen Problembewältigungsstrategien an. Sie versuchen, diese auf das neue Problem anzuwenden – was entweder gelingt oder scheitert. Tritt der letztgenannte Fall ein, sind sie gezwungen, die bisherigen Strategien anzupassen oder neue zu entwickeln, um zu einer für sie zufriedenstellenden Bewältigung des Problems zu gelangen.
Übergeordnetes Ziel derart gestalteter Unterrichtssituationen ist damit nicht länger das Vermitteln von konkreten Inhalten oder konkretem Wissen, sondern das Erarbeiten, Überprüfen und Anpassen von Problemlösungsstrategien, die anschließend in unterschiedlichsten Kontexten und auf unterschiedlichste Inhalte angewendet werden können.
Quellen:
Becker, Fred G. et al. (2010): „Einsatz des Problemorientierten Lernens in der betriebswirtschaftlichen Hochschullehre“. In: WiSt. Wirtschaftswissenschaftliches Studium. Heft 8. August 2010. S. 366-371.
Krönert, Lukas (2021): „Die Lerntheorie des Konstruktivismus“. In: intrapsychisch.de. Online verfügbar unter: https://intrapsychisch.de/die-lerntheorie-des-konstruktivismus/ [02.12.2021].
Meir, Sabine (o. J.): Didaktischer Hintergrund und Lerntheorien. Stuttgart. Online verfügbar unter: https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/praxis/einfuehrung/material/2_meir_9-19.pdf [02.12.2021].
Reusser, Kurt (2005): „Problemorientiertes Lernen – Tiefenstruktur, Gestaltungsformen, Wirkung“. In: Beiträge zur Lehrerbildung. 23. Jg. Heft 2. S. 159-182.